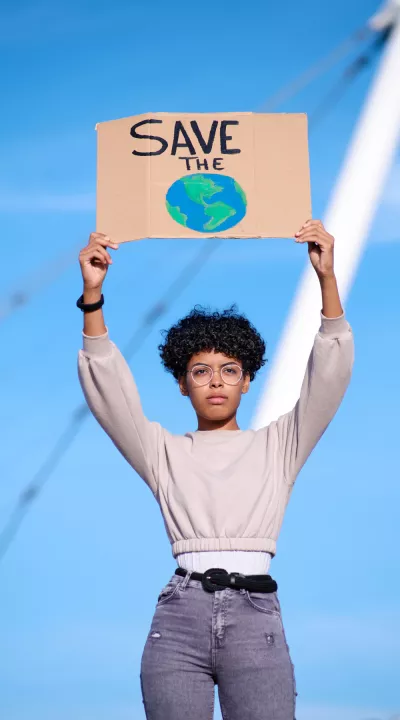Wie Europa Good Governance in den ukrainischen Kohleregionen fördern kann

Samarska Kohlemine, Nähe Terniwka.
Copyright: Leonid Dzhepko CC-BY-SA-2.5.
Die marode Kohlewirtschaft stellt die Ukraine vor eine Vielzahl von Problemen: Die Bergbauregionen brauchen neue wirtschaftliche Perspektiven und mit dem Erbe rücksichtsloser Umweltverschmutzung muss einen Umgang gefunden werden. Trotz Krieg hat sich die Ukraine außerdem international verpflichtet, aus der Kohleförderung auszusteigen. Die staatlichen Bergwerke sollen bis 2035 schließen, die privatwirtschaftlichen sollen bis 2040 folgen.
Sind das wichtige Probleme im Angesicht des Krieges? Auf den ersten Blick scheint die Frage vernachlässigbar, ob der Strukturwandel und eine verantwortungsvolle Umwelt- und Gesundheitspolitik in den Kohlerevieren gelingen. Viele Probleme der Kohlereviere sind jedoch eng verknüpft mit den zentralen nicht-militärischen Herausforderungen des Landes: mit dem Kampf gegen Korruption und mit der Eindämmung oligarchischer Macht. Die ukrainische Regierung stellt sich auch in Kriegszeiten diesen Herausforderungen und treibt weiter Antikorruptionsreformen voran. Entwicklungspolitische Zusammenarbeit zur Förderung des Strukturwandels in Kohleregionen bleibt daher weiterhin sinnvoll. So etwa das Projekt „Einen gerechten Übergang in den ukrainischen Kohleregionen ermöglichen“, das die GIZ im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums durchführt. Was genau kann Europa tun?
Krieg bremst die Energiewende im Südosten aus
Der Großteil der Kohlereviere befindet sich im Südosten des Landes. Sie sind zum Teil von Russland besetzt oder befinden sich nur wenige Kilometer von der Front entfernt. Die 100.000-Einwohner*innen-Stadt Pawlohrad, das aktuell wichtigste Zentrum des Steinkohlebergbaus, ist rund 150 Kilometer von der Front entfernt. Russland bombardiert die ostukrainischen Industrieregionen weiterhin stark. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Krieg noch viele Jahre dauert. Unter diesem Vorzeichen muss Entwicklungszusammenarbeit in der Region pragmatisch sein.
Der Krieg ist erschwert die Umsetzung der Energiewende. Private Investoren fürchten um Solar- und Windkraftanlagen, weil russische Luftangriffe oft auf die Energieinfrastruktur abzielen. So hat etwa ein großer, in Pawlohrad ansässiger Lebensmittelkonzern sein Fotovoltaik-Projekt aufgrund der Gefahr durch Bombenangriffe bis zum Ende des Krieges aufgeschoben. In unmittelbar vom Krieg betroffenen Regionen ist keine Entwicklungszusammenarbeit möglich. Falls die Lage in der Region Dnipropetrowsk und in der Westukraine weiter stabil bleiben sollte, könnte ein Schwerpunkt der Entwicklungszusammenarbeit die Verbesserung der regionalen Good Governance sein.
Umweltverschmutzer werden zu wenig kontrolliert
Die Kohlebergwerke im Kreis Pawlohrad verursachen massive Umweltzerstörung und schaden der Gesundheit der lokalen Bevölkerung. Toxischer Staub weht von den Abraumhalden in die Wohnsiedlungen von Städten wie Terniwka und Perschotrawensk. Die Fördertürme, die oftmals selbst mit Kohle betrieben werden, sowie die lokalen Heizkraftwerke arbeiten weitgehend ohne Filter. Umweltverschmutzer wie der Energiekonzern DTEK, der die wichtigsten ukrainischen Bergwerke betreibt, werden wenig kontrolliert. Geldstrafen und Schadensersatzansprüche beim Verstoß gegen Umweltauflagen sind niedrig. In vielen Fällen können Industriekonzerne Kontrollen durch die Umweltinspektion verweigern. Die Verweigerung kostet ein Unternehmen nur 750 Hrywnja (circa 18 Euro). Das ist ein Bruchteil der Summe, die man für umweltrechtliche Verstöße zahlen würde, erklärte im Jahr 2020 Andrij Maljowanyj, Leiter der staatlichen Umweltinspektion, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Interfaks-Ukraina. Einige Unternehmen ließen die Umweltinspektor:innen häufig erst gar nicht auf ihre Betriebsgelände, darunter auch DTEK, sagt Maljowanyj.
Seit dem 24. Februar 2022 gilt in der Ukraine das Kriegsrecht. Dadurch sind die Befugnisse der staatlichen Umweltinspektion noch weiter eingeschränkt. Im Kreis Pawlohrad nimmt die Umweltinspektion bei Verdachtsfällen von rechtswidriger Umweltverschmutzung keine Ermittlungen auf. Seit Februar 2022 wurde über die staatliche Umweltinspektion eine Art Moratorium zur Durchführung von Ermittlungen verhängt, erklärt Oleksandr Snisar vom Anti-Corruption Council, einer NGO aus Dnipro. Wenn sich Bürger bei den Aufsichtsbehörden über gesundheitsschädliche Emissionen beschweren, bleibt das zumeist wirkungslos. Hier könnte die EU in den Gesprächen mit der Partnerin Ukraine viel bewirken. Bereits in der Vergangenheit haben sich EU-Politiker:innen gegenüber der ukrainischen Regierung für die Rückkehr zu üblichen rechtsstaatlichen Prozeduren eingesetzt.
Was freie Medien bewirken könnten
Auch mediale Berichterstattung würde die Einhaltung ökologischer Normen forcieren. Im Kreis Pawlohrad arbeiten derzeit nur wenige Journalist:innen. Einen Großteil ihrer Arbeit machen sie quasi ehrenamtlich unter hoher persönlicher Opferbereitschaft. Es braucht mehr Ressourcen, damit sie ihre Arbeit unbeeinflusst von oligarchischen Machtstrukturen ausüben können. Hierfür könnte die EU ihre Programme zur Unterstützung von investigativem Journalismus in der Ukraine ausbauen. Dies empfiehlt auch der Europäische Rechnungshof in einer Bestandsaufnahme der europäischen Ukrainepolitik. In einer Studie zu Antikorruptionspolitik fordert der German Marshall Fund, dass die EU einen dreistelligen Millionenbetrag zugunsten des ukrainischen Journalismus investieren sollte: in die Stärkung von Netzwerken, in Fortbildungen zu Umweltthemen oder journalistischer Berufspraxis sowie unmittelbar in den Aufbau unabhängiger Medien. Programme wie die EU Anti Corruption Initiative, die den ukrainischen Journalismus fördern, sollten unserer Meinung nach nicht nur in Metropolen wie Kyjiw, Odesa und Lwiw Wirkung erzielen, sondern auch in den Kohleregionen ankommen.
Auch in Kriegszeiten haben die Ukrainer:innen in Kohleregionen ein Recht darauf, saubere Luft zu atmen. Auch in Kriegszeiten muss eine Versorgung mit gesundem Trinkwasser gewährleistet sein. Durch die Stärkung der Medien und der staatlichen Aufsichtsbehörden können diese Rechte eher durchgesetzt werden. Die gesellschaftliche Akzeptanz für den anstehenden Kohleausstieg wird steigen, wenn die Schattenseiten der Kohleförderung genauer beleuchtet werden.
Die Pawlohrader Zivilgesellschaft lobt die Kommunalverwaltung dafür, dass sie in den letzten Jahren eine demokratische Kultur etabliert hat. Noch vor der „Revolution der Würde“ 2014 haben Stadtverwaltungen in der Südostukraine die Zivilgesellschaft häufig als Bedrohung wahrgenommen. Nun arbeiten Kommunen oftmals eng mit Vereinen zusammen. Man begreift die Zivilgesellschaft als Bereicherung. Zugleich scheint ein tiefes Misstrauen der Bürger gegenüber dem Staat noch weit verbreitet zu sein. Davon kann man in Gesprächen in Pawlohrader Taxis oder im Bus schnell einen Eindruck gewinnen.
Kommunen und die Regierung können diesem Misstrauen weiter entgegenwirken, wenn sie glaubhafte Beteiligungsprozesse für den Strukturwandel etablieren. Energiekonzerne haben generell die Verantwortung für die ökologischen und gesundheitlichen Folgekosten des Bergbaus und sollten sich überall an strenge Regeln zur größtmöglichen Minimierung von Umweltschäden halten müssen. Die Europäische Union und Deutschland sollten die Ukraine dabei mehr als bisher unterstützen.
Autor:innenLukas Latz |
|
ZitiervorschlagLatz, L., 2024, Wie Europa Good Governance in den ukrainischen Kohleregionen fördern kann. |