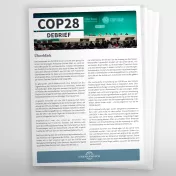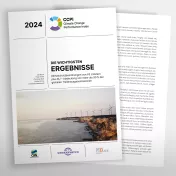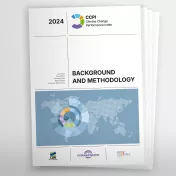Was Sie über die 28. Weltklimakonferenz wissen müssen
- Welche Themen stehen bei der COP28 im Vordergrund?
Diejenigen, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, leiden am meisten unter ihren Folgen. Dieser Gerechtigkeitsskandal steht im Zentrum der Arbeit von Germanwatch. Auf der COP28 setzen wir uns an der Seite progressiver Regierungen und gleichgesinnter Nichtregierungsorganisationen für ambitionierte Lösungen ein:
- Für einen schnellen Ausstieg aus allen fossilen Brennstoffen.
- Für eine bessere und messbare Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit von Staaten gegenüber dem Klimawandel.
- Für eine Erhöhung der Summe, die die internationale Gemeinschaft den Ländern des Globalen Südens jährlich bereitstellt, um Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel, kohlenstoffarme Entwicklung und den Umgang mit Schäden und Verlusten zu finanzieren – orientiert an den Bedarfen vor Ort.
- Dafür, den Auftrag und die Arbeitsweise des Fonds für klimawandelbedingte Schäden und Verluste festzulegen.
Nach jahrelangen schwierigen Verhandlungen wurde auf der COP27 ein Fonds zur finanziellen Unterstützung beim Umgang mit klimawandelbedingten Schäden und Verlusten beschlossen. Damit der Fonds zeitnah einsatzfähig wird, müssen in Dubai u. a. diese Kernpunkte entschieden werden:
Wer profitiert? Wir setzen uns dafür ein, dass die verwundbarsten Menschen und Gemeinschaften im Zentrum des Fonds stehen. Er soll so neben den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselstaaten auch weitere stark betroffene Länder wie Pakistan oder Libyen unterstützen.
Wann wird gezahlt? Aus unserer Sicht soll der Fonds sowohl bei Sachschäden, z. B. an Infrastruktur, unterstützen, als auch beim Umgang mit Verlusten, die nicht monetär erfasst werden können, z. B. von Menschenleben, Biodiversität und Kulturgütern. Er soll sowohl bei schleichenden Prozessen, wie dem Meeresspiegelanstieg, als auch bei Extremwettereignissen, wie Starkregen, greifen.
Wer füllt den Fonds? Wir sehen reiche und emissionsintensive Länder besonders in der Verantwortung. Industrieländer wie Deutschland haben historisch gesehen am meisten Treibhausgase verursacht. Sie sollten vorangehen und in Dubai konkrete Summen ankündigen. Ein solches Signal könnte andere Länder veranlassen, nachzuziehen.Autorin: Vera Künzel (Referentin für Anpassung an den Klimawandel und Menschenrechte)
- Welche Rolle spielt die emiratische Präsidentschaft?
In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) laufen die Vorbereitungen für die Weltklimakonferenz auf Hochtouren. Die emiratische Präsidentschaft plant die größte COP aller Zeiten mit so vielen Teilnehmer:innen wie noch nie.
Dennoch stehen die VAE in der Kritik: Sie besitzen mit die größten Öl- und Gasreserven weltweit und haben damit enormen Reichtum aufgebaut. Die Pro-Kopf-Treibhausgasemissionen des Landes gehören zu den höchsten weltweit und die nationalen Klimaziele sind unzureichend. Darüber hinaus setzen die VAE weiterhin darauf, neue Öl- und Gasfelder im In- und Ausland zu erschließen oder finanzieren solche Projekte. Das Land hat es über Jahre hinweg verpasst, seine Methan-Emissionen bei den Vereinten Nationen zu melden und möchte fossile Energieunternehmen an den Klimaverhandlungen beteiligen. Das beeinträchtigt die Glaubwürdigkeit der VAE massiv.
Auch der designierte COP-Präsident Dr. Sultan al-Jaber ist umstritten. Er ist Minister für Industrie und Fortschrittstechnologien und auch CEO der staatlichen Ölgesellschaft.
Medienberichte über die Manipulation von Wikipedia-Artikeln zu al-Jaber und zur COP28 bestätigen Interessenkonflikte. Wichtiger ist aber, dass die VAE nicht die schnelle Abkehr von allen fossilen Energien unterstützen – eine der Hauptfragen dieser COP. Deshalb haben 130 Politiker:innen aus Europa und den USA öffentlich gefordert, den COP-Präsidenten abzusetzen – bislang ohne Reaktion.
Hinzu kommt die prekäre Menschenrechtslage in den VAE. So gibt es etwa zahlreiche Fälle von willkürlichen Inhaftierungen und Einschränkung der Meinungsäußerung. Wir erwarten von den anreisenden Politiker:innen, dass sie dieses Thema neben den Verhandlungen nicht unter den Tisch fallen lassen. Die Lage ist kompliziert und Teile der Zivilgesellschaft haben schon Konsequenzen angekündigt. So haben schwedische Nichtregierungsorganisationen u. a. deshalb
ihre Teilnahme abgesagt. Germanwatch hat sich hingegen für eine Teilnahme entschieden, weil wir vor Ort mehr bewirken können als in Deutschland. Zudem ist die COP – auch in Dubai – eine wichtige Kommunikationsplattform, um unseren Themen Gehör zu verschaffen.Autorin: Katharina Hierl (Referentin der Politischen Geschäftsführung)
- Wie arbeitet Germanwatch auf einer COP?
Die Klimaverhandlungen finden formell zwischen den 198 Vertragsstaaten statt. Organisationen wie Germanwatch tragen mit ihrem Engagement zwischen und während den COPs dazu bei, dass die Verhandlungen möglichst nicht ins Stocken geraten, und dass sich die Belange aus der Zivilgesellschaft und Erkenntnisse der Wissenschaft in den Ergebnissen widerspiegeln.
Germanwatch zählt zu den wenigen Organisationen, die bereits seit der ersten COP 1995 in Berlin jedes Jahr vor Ort sind. Als Beobachter:innen nehmen wir an Verhandlungen zu Themen wie Emissionsminderung und Klimafinanzierung teil. So erfahren wir aus erster Hand, welche Regierungen welche Positionen vertreten. Anschließend erklären und bewerten wir die aktuellen Entwicklungen für die deutsche und internationale Presse.
Abseits der formalen Verhandlungen versuchen wir Brücken zu bauen: sowohl zwischen Industrieländern und Ländern des Globalen Südens als auch zwischen Vertreter:innen von Regierungen, Zivilgesellschaft und weiteren Akteur:innen. Dafür organisieren wir offizielle Nebenveranstaltungen, Working Dinners oder strukturiertere Treffen, die zu Austausch, Lernen und gegenseitigem Verständnis anregen sollen. Letztes Jahr haben wir z.B. Vertreter:innen von Geldgeber- und Empfängerländern zusammengebracht und die Chancen von Partnerschaften für eine gerechte Energiewende diskutiert.
Mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen treffen wir uns in breiten Netzwerken und in thematischen Arbeitsgruppen, um bei den Verhandlungen auf dem Laufenden zu bleiben, die wir nicht selbst besuchen können. Gemeinsam koordinieren wir auch Positionen und Aktionen und entwickeln politische Strategien. Zum Beispiel werden wir genau wie im letzten Jahr auch dieses Mal täglich an Arbeitsgruppen zum Umgang mit klimawandelbedingten Schäden und Verlusten teilnehmen oder als Mitglied des Climate Action Networks die globale Umsetzung der Klimaschutzziele bilanzieren.Autor: Petter Lydén (Bereichsleiter Internationale Klimapolitik)
Themenseiten der UN-Klimakonferenzen
2024: COP29 in Baku/Aserbaidschan
2022: COP27 in Sharm El Sheikh/Ägypten
2017: COP23 in Bonn/Deutschland
2016: COP22 in Marrakesch/Marokko
2015: COP21 in Paris/Frankreich
Archiv: Hintergrundpapiere vergangener UN-Klimakonferenzen
Germanwatch begleitet seit vielen Jahrzehnten alle UN-Klimakonferenzen mit informationsreichen Hintergrundpapieren.
Einen Überblick über alle Veröffentlichungen finden Sie hier >>